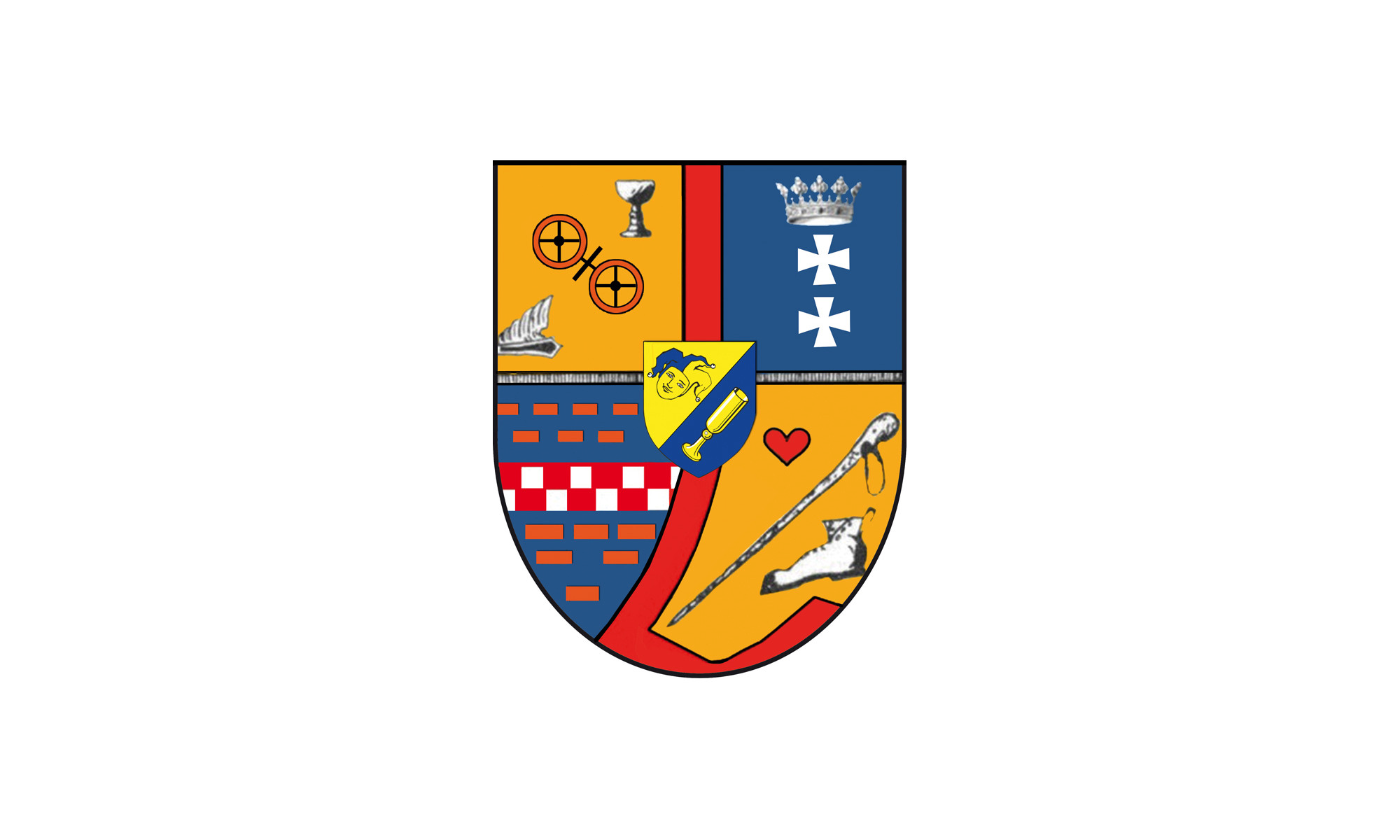Was ist Schlaraffia?
Im Schlaraffenland des Geistes
von Michael Schuld
Wir alle kennen die Geschichte vom Schlaraffenland, einem Land, in dem uns gebratene Hühner entgegen fliegen, in dem die Völlerei regiert, weil es alles Materielle im Überfluss gibt.
Gerne wäre man als Kind einmal im diesem Schlaraffenland gewesen, doch wir alle wissen, dass es dieses Land des materiellen Überflusses leider nur im Märchen gibt.
Nur relativ wenige Menschen wissen allerdings um ein anderes Schlaraffenland, das es aber gibt, das man tatsächlich betreten und das denjenigen, der darin weilt, unendlich weit weg führen kann von den Sorgen des Alltags und ihn frisch gestärkt und mit einem Quäntchen Gelassenheit versehen zurückkehren lässt in das tägliche Ringen um Macht und Geld, in eine Welt, die gekennzeichnet ist von Konsum und wachsender Anonymität.
Es ist die Rede vom Schlaraffenland des Geistes, in dem eben geistigen Genüssen zugesprochen wird anstatt materiellen.
Sicherlich gibt es unter Ihnen, liebe Leser viele, die es sich vorstellen können, dieses wunderbare Land einmal zu betreten, es zu durchwandern und zu prüfen, ob es nicht angenehm wäre, es des Öfteren zu besuchen und schließlich heimisch zu werden in diesem Land.
Dieses Schlaraffenland des Geistes öffnet seine Tore demjenigen, der sich in der Schlaraffia einfindet, jenem Bund von Männern, der sich zusammengeschlossen hat, um Kunst und Humor zu pflegen und die Freundschaft untereinander hoch zu halten.
Rund 9000 dieser Männer, – sie heißen übrigens Schlaraffen -, gibt es in der ganzen Welt, mit Schwerpunkt aber im deutschsprachigen Raum, denn in der Schlaraffia wird deutsch gesprochen, ob man nun in Paris, in Boston, Mexico City, auf Mallorca oder eben in Limburg zusammen kommt.
Überall in den Reychen, – so heißen die weltweit über 250 Ortsvereine der Schlaraffia -; ist man willkommen bei den Zusammenkünften, den so genannten Sippungen, überall ist man sofort ganz freundlich und selbstverständlich aufgenommen, ist unter Freunden, auch wenn man zum ersten Mal ein Reych besucht.
Man kann also Kontakte zu durchaus interessanten Menschen knüpfen und pflegen in der Schlaraffia und Gleichgesinnte finden, die einem vorher fremd gewesen sind; – welch’ neue Möglichkeiten tun sich einem Suchenden hier auf !
Die Fragen, wer Schlaraffe werden kann und welche Eigenschaften man dazu haben muss, sind leicht beantwortet:
Männer von unbescholtenem Ruf in gesicherter Stellung können Schlaraffen werden.
Obwohl es auch Schlaraffen gibt, die jünger als 30 Jahre alt sind, wird als ein gutes Eintrittsalter die Zeit zwischen dem 35. und 40. Lebensjahr angesehen. Nach oben ist natürlich keine Grenze gesetzt.
Viel wichtiger als das Alter sind die Neigungen desjenigen, der Schlaraffe werden will. Sie sind die Basis für die Freude am schlaraffischen Tun und der daraus entstehenden inneren Zufriedenheit, die Schlaraffia zu geben vermag.
Männer, die den Künsten zugetan sind, sind potenzielle Schlaraffen.
Solche, die etwa die Literatur verehren, die gerne selbst etwas schreiben, sei es nun Lyrik oder Prosa, oder die gerne etwas vortragen oder Theater spielen, ob nun heiter oder besinnlich, sind in Schlaraffia willkommen.
Musikalische Darbietungen sind besondere Highlights und sehr gerne in Schlaraffia gehört. So sind all diejenigen, die gerne singen, ob nun alleine oder gemeinsam mit anderen, die vielleicht ein Instrument spielen, in Schlaraffia gern gesehen.
Auch sollten sich Männer angesprochen fühlen, die einfach gerne zuhören, wenn Freunde, ob nun Profi oder Laie etwas zum Besten geben.
All’ diejenigen Männer können also das Schlaraffenland des Geistes betreten, die Spaß daran haben, sich in fröhlicher Runde aktiv oder passiv mit den schönen Künsten auseinander zu setzen.
Tolerant muss der Schlaraffe sein und stets darauf bedacht, den Freund nicht zu verletzen, denn die Hochhaltung der Freundschaft ist der wesentliche Grundpfeiler, auf dem Schlaraffia ruht.
Der Beruf spielt eine untergeordnete Rolle.
In der Schlaraffia sind Männer der unterschiedlichsten Berufe beisammen. Hier findet sich der Chirurg neben dem Handwerksmeister, der Lehrer neben dem Soldaten oder Musiker, der Universitätsprofessor neben dem Unternehmer oder dem Angestellten.
Sie alle vereint der Wunsch, sich mit Freunden im Schlaraffenland des Geistes an Kunst und Humor zu ergötzen, bevor sie dann, beseelt von dem Erlebten, auseinander gehen, um sich frisch gestärkt und mit einem Lächeln der Gelassenheit wieder den Herausforderungen des Alltags zu stellen.
Auch mancher Ruheständler hat in Schlaraffia noch seine Erfüllung gefunden.
Das bisher Gesagte mag dem Leser ein Bild von einigen fröhlichen Männern mittleren bis fortgeschrittenen Alters zeichnen, die sich ab und zu irgendwo treffen, um miteinander zu plaudern und vielleicht ein Liedchen zusammen zu singen.
Damit stellt sich die Frage, was nun das Besondere an Schlaraffia ist, das diesen Bund etwa von einem Gesangverein oder einer Stammtischrunde unterscheidet.
Nun, die Beantwortung dieser Frage sei mit dem Hinweis eingeleitet, dass schlaraffisches Tun nach exakt festgelegten Regeln abläuft, die unbedingt einzuhalten sind.
So finden die Sippungen, die in der Regel wöchentlichen Zusammenkünfte, nur in der Zeit zwischen Oktober und April, also im Winter statt.
Für manche unserer Schlaraffen ist dies zu wenig und so besuchen sie regelmäßig die Nachbarreyche Limburgs, wie etwa Wetzlar, Gießen, Marburg, Herborn, Siegen, Frankfurt, Wiesbaden, Mainz oder Koblenz, um dort ebenfalls an Sippungen teilzunehmen, denn man ist ja als Schlaraffe in allen Reychen gern gesehen und trifft immer auf Freunde.
Die Sippungen stehen meist unter einem bestimmten Motto, wie z.B. „Die Mundart“ oder „Lügengeschichten“, „Steckenpferde“ oder „Märchen und Sagen“ und dieses Motto gibt eine grobe Richtung vor, in die die Vorträge, die man freiwillig zum Besten geben kann, gehen sollten. Unabhängig von dieser Vorgabe steht es jedem Schlaraffen frei, zu jedem Thema, das ihm gerade beliebt, vorzutragen.
Vielleicht ist er gerade von einer Reise zurückgekehrt und möchte davon berichten oder er hat auf seinem Instrument ein Stück einstudiert, das er vortragen möchte.
Die freudige Anerkennung seines Vortrages durch die Anwesenden ist ihm sicher, vorausgesetzt er verletzt bei seinen Äußerungen kein Tabu.
So möchte man in der Schlaraffia weder den flachen Witz noch die Zote hören. Auch sind Themen, die sich um Politik oder Religion ranken, verpönt.
Ein kritisch humorvoller Blick auf uns selbst und unsern Alltag ist jedoch stets willkommen.
Gerade die Persiflage ist das belebende Element schlaraffischen Tuns, sind doch die Zusammenkünfte in ein Rollenspiel gekleidet, bei dem jedem Mitspieler, also den Schlaraffen selbst, Rollen zugewiesen sind und das nach fest vorgegebenen und unumstößlichen Regeln abläuft.
Gespielt wird eine mittelalterliche Rittertafel, wie man sie sich etwa im 11. Jahrhundert vorstellen mag.
Es gibt einen Thron, von dem aus die gar festliche Versammlung geleitet wird, es gibt dem Thron zugeordnete Beamte, die ein Protokollum anfertigen und Würdenträger, die während der Sippung die unterschiedlichsten Aufgaben ausführen. So wie etwa einen Mundschenk, der die Gäste mit Wein begrüßt, einen Zeremonienmeister, die für den ordnungsgemäßen Ablauf bestimmter Programmteile verantwortlich ist, einen Zinkenmeister, der das Klavier bedient usw.
Neben den Würdenträgern gibt es die Ritter, die sich an der Tafel versammelt haben und Allerlei vorbringen, um das Spiel zu beleben. Daneben ist der schlaraffische Nachwuchs zu nennen. Es sind die Junker und Knappen, die unter der Obhut des Junkermeisters am Spiel teilnehmen und seine Regeln erlernen.
Sehr oft sind auch Ritter, Junker oder Knappen aus anderen Reychen anwesend, die mitspielen, so dass man immer wieder neue Bekanntschaften schließen kann.
Der Fehdehandschuh für das Duell wird gebracht
Das Spiel lebt von Rede und Gegenrede, von Vorträgen besinnlicher und humorvoller Art, von Duellen, die mit geistigen Waffen ausgetragen werden, von Ordensverleihungen und von (symbolischen) Strafen. Alles fügt sich zu einem fröhlichen Beisammensein, bei dem es keinen Platz für Zank und Streit, Neid und Missgunst oder Schwermut und Traurigkeit gibt. Neben der Ratio, die in einem klugen Gedankenaustausch unverzichtbar ist, regiert vor allem das Gefühl, das Herz. „Das Herz gehört dazu“, ist daher einer der Kernsätze Schlaraffias.
Die Reichhaltigkeit des schlaraffischen Spiels und die Verschiedenartigkeit der anwesenden Charaktere gewährleisten, dass jeder Sippungsabend einzigartig und sein Verlauf, obwohl in Grundzügen vorgegeben, nie vorhersehbar ist.
Das Spiel selbst wird hinsichtlich der Beachtung seiner Regeln mit großem Ernst betrieben und findet in Räumlichkeiten statt, die einer Burg nachempfunden sind. Auch die Spieler sind in bestimmte Gewänder gekleidet und so ihrem Stande im Spiel nach zu unterscheiden.
Dem Unbedarften mag beim Gedanken an eine Kostümierung der Karneval als Verwandter des schlaraffischen Spiels in den Sinn kommen.
Obwohl Karneval und Schlaraffia gemeinsame Wurzeln haben, gibt es in der heutigen Praxis erhebliche Unterschiede. Schlaraffia ist heute vom Karneval ebenso weit entfernt wie von der lockeren Stammtischrunde, auch wenn die Kopfbedeckungen, die in den Sippungen getragen werden, Narrenkappen, wie man sie aus Karnevalssitzungen kennt, durchaus ähnlich sind.
Die Sprache des Spiels ist zwar Deutsch, aber es ist ein mittelalterlich verbrämtes Deutsch, das so genannte „Schlaraffenlatein“, das dem schlaraffischen Spiel eine besondere Würze gibt.
Nur durch ernsthafte Beachtung der Spielregeln gelingt es, sich für etwa 3 Stunden, die eine Sippung, unterbrochen durch eine Pause; dauert, völlig aus dem Alltagsleben zu entfernen, um sich für diese begrenzte Zeit im Schlaraffenland des Geistes aufzuhalten. Dies aber ist der eigentliche Zweck des schlaraffischen Spiels.
Eine Figur des Spiels : „Der Nachtwächter“
Das Spiel, das „so tun, als ob…“ befördert die Fröhlichkeit des Ganzen ungemein, obwohl, – das mag zugestanden sein -, dies Treiben reiferer Herren dem Neuling durchaus etwas kurios erscheinen mag und er es zunächst vielleicht mit einem inneren Kopfschütteln quittieren wird.
Erst bei näherer Beschäftigung mit dem schlaraffischen Spiel, gibt dieses seinen Sinn und seine Psychologie preis, sein wahrer Wert wird allerdings erst dem Mitspieler überdeutlich.
Dies scheint beabsichtigt von denen, die das Spiel erdacht haben.
Toleranz, ein wichtiger schlaraffischer Charakterzug, wird von einem Neuling in der Betrachtung erwartet und seine Neugier wird geweckt. Es ist jene Neugier, die Kinder zeigen, wenn sie etwas Neues erleben, und die zur Beschäftigung mit dem Erlebten und, im Falle Schlaraffias, schließlich zum Verlangen führt, ein bisher unbekanntes Land zu entdecken und es zu bereisen: das Schlaraffenland des Geistes.
Toleranz und der Mut, sich auf etwas Neues einzulassen, sind also zunächst die Schlüssel zu jenem Land.
Der Gebrauch dieser Schlüssel stellt gleichsam die erste Herausforderung Schlaraffias an einen Neuling dar.
Der Neuling, der durch einen Schlaraffen zu einer Sippung mitgebracht wird, kann mit freundlicher Aufnahme und sofortiger Einbindung in das Spiel rechnen.
Zunächst ist er ein Pilger, der sich das Treiben näher besieht und vielleicht Geschmack daran findet.
Ist dies der Fall, so wird er zum Prüfling, der sich selbst prüft, ob er Schlaraffe werden will. Äußert er den Wunsch nach Aufnahme in Schlaraffia und auch die Schlaraffen sind einverstanden, wird er ein Knappe, der das schlaraffische Spiel erlernt.
Vom Knappen wird er zunächst zum Junker, bevor er nach einer vorgegebenen Zeit den höchsten Stand im schlaraffischen Spiel erreicht, den eines Ritters. Er erwählt sich einen Ritternamen, mit dem er fortan überall in Schlaraffia im Rahmen des Spiels angesprochen wird.
Das schlaraffische Spiel hat nichts mit den so populären Rollenspielen der modernen Zeit gemein.
Es wurde im Jahre 1859, in der Zeit der Romantik also, von einer Gruppe von Theaterschauspielern in Prag erdacht und fand rasch Verbreitung über die ganze Welt.
Es hat die Stürme der Zeit überstanden und weder sein Verbot während der NS Zeit noch seine Ächtung durch die sozialistischen Diktaturen Osteuropas haben zu seinem Verschwinden von der Bühne der Kultur geführt.
Es ist ein altes und sehr weises Gesellschaftsspiel, das, wenn es regelkonform gespielt wird, nur Gewinner kennt.
Es dient nicht der Indoktrination oder der Pflege elitärer Zirkel, sondern möchte den, der es aus freiem Willen gerne und ernsthaft mitspielt, für eine begrenzte Zeit in jenes oben beschriebene Schlaraffenland des Geistes führen und ihn bereichern.
Am Ende wird die Forderung Schlaraffias an die Mitspieler, sich mit allem Ernste den Regeln dieses fröhlichen Spiels bedingungslos zu unterwerfen reich belohnt.
Schlaraffia ist ein Männerbund, da das Spiel, das im Mittelpunkt des schlaraffischen Tuns steht, die Teilnahme von Frauen nicht vorsieht. Dennoch werden auch die Frauen in Schlaraffia berücksichtigt. Sie lernen einander kennen und unternehmen zuweilen auch manches gemeinsam, während sich die Männer zu den Sippungen treffen.
Zu besonderen Anlässen, etwa in der Weihnachtszeit oder zum Jahreswechsel finden auch Sippungen statt, an denen die Frauen als Gäste teilnehmen.
Im Sommer, also in der sippungsfreien Zeit gibt es in der Schlaraffia zahlreiche kulturelle und gesellige Veranstaltungen, zu denen stets auch die Frauen eingeladen sind.
So sind auch unsere Frauen eingebunden und es gibt nicht wenige unter ihnen, die Schlaraffia nicht mehr missen wollen.
Schlaraffia organisiert sich im Rahmen von Vereinen und man muss hier beitreten, wenn man Schlaraffe sein will. Diese Vereine sind darüber hinaus in Sprengeln und Landesverbänden und schließlich im Gesamtverband Allschlaraffia organisiert.
Der Verband gibt neunmal im Jahr eine Zeitung heraus, die jedem Schlaraffen per Post zugesandt wird. Im Mitgliedsbeitrag enthalten ist auch die jährlich durch den Verband veröffentlichte „Allschlaraffische Stammrolle“, ein Buch, in dem die Namen und Adressen aller 11 000 Schlaraffen verzeichnet sind. Ein Büchlein, in dem die vorgesehenen Sippungen aller Reyche in einem Winter aufgeführt sind, die so genannte „Sippungsfolge“ rundet die Versorgung des Schlaraffen mit Informationen über das aktuelle Geschehen ab.
Darüber hinaus ist Schlaraffia auch im Internet vertreten. Dem Interessierten öffnet sich unter der Adresse www.schlaraffia.org die Hauptseite des Verbandes Allschlaraffia.
In Limburg gibt es seit nunmehr fast 60 Jahren den Verein „Schlaraffia Lympurgia e.V.“
Über Schlaraffia, besonders aber über das schlaraffische Spiel, das zentrale Element schlaraffischen Tuns, könnte man noch Vieles niederschreiben.
Aber da der Mensch bekanntlich aus eigenem Erleben am Besten lernt, muss man das schlaraffische Spiel einmal erlebt haben, um sich ein eigenes Bild von Schlaraffia machen zu können und diejenigen kennen lernen, die diesem Bund seit Jahren begeistert angehören.
Falls Sie, lieber Leser vielleicht nun in Ihrem Innersten das Gefühl haben, dass Schlaraffia auch Sie ansprechen könnte, weil Sie hier
– neue, interessante Bekanntschaften schließen,
– für eine begrenzte Zeit dem Alltag entfliehen,
– Ihre künstlerischen Talente entdecken oder fördern
können, sollten Sie nicht zögern, sich dieses eigene Erleben des schlaraffischen Spiels einmal zu gönnen und einen der unten aufgeführten Herren kontaktieren, um alsbald alleine oder auch mit einem Bekannten einmal eine unserer Sippungen in Limburg zu besuchen.
Sie wären nicht der Erste, der diesen ersten Schritt, den man nun einmal alleine tun muss, getan und es nicht bereut hat !
Die Schlaraffia Lympurgia trifft sich zwischen Oktober und April an jedem 2. und 4. Freitag im Monat, in ihrer „Burg“ in der Josef-Ludwig-Str. 7 in Limburg.
Wir würden uns über eine Kontaktaufnahme und den Besuch einer unserer Veranstaltungen sehr freuen.
Kontaktpersonen: Impressum